Vom Hörsaal… aufs Reisfeld!
Feldforschung in Thailand: Geographin Judith Bopp untersucht, wie ökologische Landwirtschaft kleinbäuerliche Haushalte widerstandsfähiger macht.
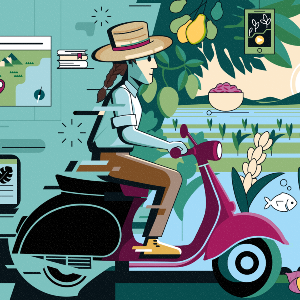
Feldforschung in Thailand: Geographin Judith Bopp untersucht, wie ökologische Landwirtschaft kleinbäuerliche Haushalte widerstandsfähiger macht.
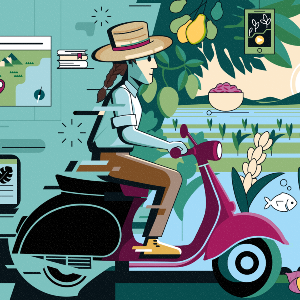
Mit fünf thailändischen Bäuerinnen sitze ich auf dem Küchenboden. Vor uns liegt ein großer Haufen frisch geernteter Süßkartoffeln, noch von Erde und feinen Wurzelranken überzogen. Während wir sie gemeinsam putzen und sortieren, sprechen wir über Bodenqualität, Abnahmepreise, das Wetter der letzten Saison. Wenn die Hände beschäftigt sind und die Stimmung gelöst ist, läuft das Interview wie von selbst.
Ich bin Humangeographin am Rachel Carson Center for Environment and Society der LMU und arbeite drei Jahre lang an einem Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird: „Fostering the Health-Nutrition-Ecology Nexus: Organic Farming Practices and Household Resilience in Rural Thailand.“ Kurz: Ich untersuche, wie ökologische Landwirtschaft kleinbäuerliche Haushalte widerstandsfähiger macht – gesundheitlich, ökonomisch und ökologisch.
Dafür bin ich bereits zum zweiten Mal mehrere Monate in Thailand unterwegs. Seit meiner Promotion und teils schon währenddessen habe ich in Indien, Bangladesch und Thailand geforscht. Meine Basis diesmal ist Bangkok, wo ich seit Juli bei einer Freundin lebe. Von dort reise ich zu den Interviews in den landwirtschaftlich geprägten Norden und Nordosten, zuletzt vor allem in die Region Chiang Rai.
Mein Laptop reist überall mit, ob im Zug, Bus oder Mietwagen. Das letzte Stück aber fahre ich am liebsten auf dem Moped – so wie die Farmer selbst. Mit dem Auto würde man sofort fremd wirken, wie jemand von außen.
Meine Methode ist ethnographisch: Ich führe nicht nur Interviews, ich bleibe, beobachte, helfe mit. Ich komme auch nie mit einem strengen Fragenkatalog, sondern beginne, fast nebenher, mit einfachen Einstiegsfragen: „Was bauen Sie an?“ oder „Wie war die Ernte?“ Dass ich mich auf Thailändisch vorstelle, schafft Vertrauen – der Sprachkurs in München hat sich gelohnt.
Mit einem Bauern gehe ich durch seinen Mangohain. Die große Ernte ist längst vorbei, aber ein paar Früchte hängen noch. Ich probiere eine – sie ist herrlich süß und würzig – und frage nebenher nach den Ernteerträgen. Weil die Farmer wenig Zeit haben, laufen Gespräche oft so nebenher – unter einem Blechdach am Rande des Reisackers, beim Kochen oder während der Feldarbeit.
Feldforschung – für mich heißt das wörtlich, im Feld zu forschen. So erfahre ich, wie Entscheidungen im Alltag entstehen: Wann jemand Chemie einsetzt oder auf Bio umstellt, wie Wissen geteilt wird. Meine Notizen und Tonaufnahmen werte ich später qualitativ aus, um Muster zwischen den Haushalten zu erkennen.
Zwischen den Reispflanzen wachsen auf diesem Hof Obst und Gemüse, am Rand liegt ein Fischteich. Wer statt Monokultur auf Diversität setzt, erntet das ganze Jahr über. Familien müssen dann weniger zukaufen, ernähren sich vielfältiger und haben im Krisenfall Reserven. Viele Betriebe stellen deshalb gerade auf Bio um. Das ist hier keine Ideologie, sondern eine Praxis, die Wissen und Geduld verlangt – und sich für viele auszahlt.
Das Wissen, wie man umweltfreundlich anbaut, ist da – oft traditionell, manchmal aber auch via YouTube oder TikTok aufgefrischt. Manche Bauern haben gelernt, Reihen von Reispflanzen weiter auseinander zu setzen, damit die Luft besser zirkuliert: weniger Schimmel, weniger Fraß durch Schädlinge.
Zwei Nachbarn sind gekommen, um auf dem Feld mitzuhelfen. Später werden sie Säcke von Obst und Gemüse mitnehmen: Das starke Gemeinschaftsgefühl auf dem Dorf ist ein weiterer Faktor, der die Betriebe krisenfest macht.
Man hilft sich gegenseitig bei der Ernte, leiht Geld oder Arbeitskraft, teilt Saatgut, Gemüse und Zeit. Besonders deutlich wurde das während der Pandemie, sagen die Farmer. Als Märkte schlossen und Transportwege stockten, wurde unter den Haushalten getauscht, verschenkt und verkauft.
In einer Reismühle am Dorfrand treffe ich zehn Farmerinnen und Farmer. Deren Besitzer – ein umtriebiger Mittler zwischen Feld und Markt – hat einen Experten eingeladen, der zeigt, wie man biologische Pflanzenschutzmittel herstellt. Denn die chemischen Varianten greifen nicht nur Boden und Ernte an, sondern auch die Gesundheit der Bauern, die sie versprühen.
Ich habe selbst gesehen, wie manche Bauern bei 35 Grad Hitze mit den Kanistern auf dem Rücken übers Feld gingen und sprühten – ohne Schutzkleidung. Regelungen durch den Staat gibt es zwar, Kontrollen aber kaum. Wer es sich leisten kann, mietet eine Drohne zum Sprühen; andere aber rühren die Konzentrate mit ihren bloßen Händen ins Wasser.
Ich erhebe zwar keine medizinischen Daten, aber in meinen Gesprächen berichten die Farmer, die chemische Pestizide sprühen, von Hautausschlägen und Appetitlosigkeit nach der Feldarbeit, von Hörstörungen und gehäuften Krebsfällen.
In der Reismühle rühren wir Bananenblätter und Kräuter in Wasserkanister, um umweltfreundliche Insektenschutzmittel herzustellen. Von den Fläschchen, die wir abfüllen, darf sich jeder eins mitnehmen. Viele Anwesende erzählen offen: Wenn der Regen ausbleibt oder ein Pilz das Korn befällt, setzen sie eben doch wieder Kunstdünger ein oder bekämpfen Insekten mit Chemikalien.
Am Ende entscheidet die Ernte, ob Bio sich für sie lohnt oder nicht. Langfristig ist das ein Teufelskreis: Bei Monokultur und zu viel Dünger übersäuern die Böden, sinken die Erträge, steigen die Schulden – und es braucht noch mehr Dünger.
Auf einem Biohof, den ich anderntags besuche, schwimmen dagegen Fische und Krabben im Nassreisfeld: ein klares Zeichen für sauberes, ungespritztes Wasser – und eine weitere Nahrungsquelle für die Bauernfamilien. Zwischendurch sehe ich sogar einen Reiher, der ins Feld hinuntersticht und sich einen Fisch fängt.
Auf einer privaten Kurzreise lebte ich gerade einige Tage in einem Dorf mit traditionellen Holzhäusern. Hinter fast jedem Haus liegt dort ein Reisfeld für den Eigenbedarf – ohne Chemie. Man kocht, was der Garten hergibt: zwei Handvoll Spinat mit frischem Knoblauch angebraten – schon ist etwas auf dem Teller. Und dazu gibt es immer: Reis.
Der wird meist zweimal im Jahr angebaut, es gibt Regen- und Trockenzeitsorten. Jetzt, nach der Regenzeit, steht das Korn schwer; im Oktober und November wird geerntet. Typisch ist hier der duftende Jasminreis, der „Hom Mali“, aber es gibt auch Sorten wie roten und schwarzen Reis oder meinen Favoriten, den weichen, lilafarbenen „Riceberry“. Vor allem im Norden gehört Klebreis zum Alltag: gedämpft, mit der Hand zu Bällchen geformt und zu Herzhaftem wie Süßem gegessen.
Ich selbst esse vegan. Nicht ganz einfach in Thailand, wo Fischsoße und Krabbenpaste in fast jedem Gericht stecken. In Bangkok kenne ich buddhistische Restaurants, die rein pflanzlich kochen; und auch andernorts lässt sich mit ein paar thailändischen Sätzen vieles „ohne Fischsoße, nur mit Salz“ bestellen. Oft koche ich aber selbst, mit Gemüse vom Markt oder Mitgebrachtem von den Höfen.
Wenn ich die Farmer nach Krisen frage, winken sie ab: „Gibt es bei uns nicht.“ Erst auf Nachfrage erzählen sie von Starkregen, der Ernten zerstört, oder von Einkommenseinbrüchen im Vorjahr. Doch selbst das beschreiben sie eher als Herausforderung denn als Krise. Resilienz bedeutet hier Haltung: weitermachen, sich anpassen, Lösungen finden.
Dieses Jahr bleibe ich knapp vier Monate in Thailand. Viele Daten habe ich schon erhoben; jetzt schreibe ich – an einem Fachartikel, kleineren Stücken, Feldnotizen. Ich will verstehen, was bäuerliche Haushalte stark macht: wie Bio-Anbau, Nachbarschaft und geteiltes Wissen helfen, Krisen zu meistern.
Dabei geht es auch um den Zusammenhang von Gesundheit, Ernährung und Umwelt – und um Ideen, die in der Praxis etwas verändern können. Die Ergebnisse sollen nicht nur in der Wissenschaft ankommen, sondern auch lokalen Partnern nützen – etwa landwirtschaftlichen Kooperativen oder NGOs, mit denen ich hier zusammenarbeite.
Zwischendurch kontaktiere ich noch den einen oder anderen Farmer über Facebook oder Instagram. Soziale Medien sind in Thailand unglaublich wichtig, auch für ältere Menschen – für mich ein schneller und direkter Weg, weitere Interviews zu vereinbaren.
Parallel bereite ich einen Workshop in Indien vor, zu dem ich mit neun thailändischen Farmern reisen werde. Allein die Visa zu organisieren, kostet Zeit und Nerven. Aber für mich heißt Wissenschaft auch, die Akteure meines Forschungsthemas miteinander zu vernetzen und „Farmer-to-Farmer-Learning“ zu ermöglichen.
Ende Oktober geht es zurück nach München. Ich freue mich auf den direkten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen am Rachel Carson Center. Besonders das Fach Ecolinguistics spricht mich an: Wie erzählen wir von Landwirtschaft? Zählen wir nur Bodenparameter und Maschinenparks – oder sprechen wir auch von den Beziehungen zwischen Mensch, Boden, Wasser, Gesundheit und Nachbarschaft? Ich möchte weg von technokratischen Narrativen, hin zu Geschichten, die man leben kann.
Bis 2026 wird mein Projekt noch gefördert. Drei Jahre klingen lang für ein Projekt, für ethnographische Tiefe sind sie kurz. Nach Jahren als Antragstellerin, Einzelkämpferin und Vielreisende wünsche ich mir, meine Erfahrung danach in ein festes Forschungsteam einzubringen – gemeinsam weiterzudenken, statt immer nur parallel zu organisieren.
Aber heute, an diesem Abend in Bangkok, klappe ich den Laptop zu. Im Reiskocher köchelt mein geliebter Riceberry. Morgen stehe ich schon wieder an einem Reisfeld, pflücke vielleicht eine Papaya vom Baum – und sehe einen Reiher, der Fische fängt.
Dr. Judith Bopp ist Research Fellow am Rachel Carson Center for Environment and Society der LMU.
Lesen Sie weitere Beiträge aus dem LMU-Forschungsmagazin im Online-Bereich und verpassen Sie keine Ausgabe, indem Sie den kostenlosen Magazin-Alert aktivieren!