Mit der Nachtschicht zum Nobelpreis
04.12.2023
Vom Traum, Elektronen auf die Schliche zu kommen: Interview mit dem frisch gekürten Nobelpreisträger Ferenc Krausz, Pionier der Attosekundenphysik.
04.12.2023
Vom Traum, Elektronen auf die Schliche zu kommen: Interview mit dem frisch gekürten Nobelpreisträger Ferenc Krausz, Pionier der Attosekundenphysik.
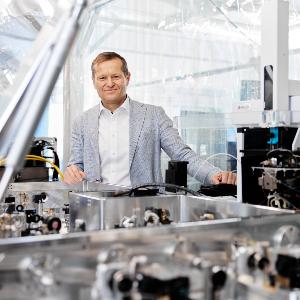
ist Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik / Laserphysik an der LMU und Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. | © Stephan Höck / LMU
Professor Krausz, inzwischen sind ein paar Wochen vergangen seit dem Anruf aus Stockholm. Können Sie das Ganze mittlerweile fassen?
Ferenc Krausz: Jein. Zwar hat sich bei mir der Eindruck verfestigt, dass die Auszeichnung Realität ist und dass ich nicht träume – nicht zuletzt durch den enormen Medienwirbel. Genau deshalb hatte ich bislang allerdings keine Zeit, mich ein bisschen zurückzuziehen und das Ganze in voller Tiefe und Breite zu verarbeiten. Das steht mir noch immer bevor.
Viel Zeit zum Forschen war zuletzt wohl nicht?
Überhaupt nicht, wobei ich in der angenehmen Lage bin, dass mir eine Weltklasse-Forscherin und mehrere Weltklasse-Forscher zur Leitung unserer Attoworld-Gruppen zur Seite stehen. Die wissen auch ohne mein Zutun sehr genau, was zu tun ist. Insofern muss diese Pause keine negativen Auswirkungen auf unsere Fortschritte haben.
Solch eine Ehrung ist über weite Strecken das Resultat von Teamarbeit.Ferenc Krausz
Wie viel Ferenc Krausz steckt eigentlich im Nobelpreis – und wie viel Arbeit von Postdocs, Doktorandinnen und Doktoranden, Studierenden?
Solch eine Ehrung ist über weite Strecken das Resultat von Teamarbeit. Absolut. Daher nehme ich den Preis auch mit allergrößter Demut entgegen – immer im Gedanken an die vielen Menschen, die in unterschiedlichen Stadien der Forschung ihre verschiedenartigen (nicht nur wissenschaftlichen) Beiträge geleistet haben. Letztlich wären all die Durchbrüche und Resultate nicht möglich gewesen ohne die Genialität und Ausdauer vieler fantastischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter zahlreiche, die nicht selbst Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sind.
Und was war Ihr entscheidender Anteil?
Zu Beginn die Fragen, die wir beantworten wollen, klar zu definieren, wie auch die konkreten Forschungsziele, die wir daraus ableiten sollten – und fest daran zu glauben, dass wir sie über kurz oder lang trotz aller Rückschläge erreichen können. Dabei helfen Hartnäckigkeit und Besessenheit, Selbstvertrauen und eine positive Einstellung. Entscheidend ist auch eine gesunde Portion Disziplin, dass man sich von neuen, interessanten Fragestellungen, die fast täglich auftauchen, die einen dem Ziel aber nicht näherbringen, keinesfalls ablenken lässt.
Die Fragestellung, die mich ursprünglich umgetrieben hat, lautete vor vielen Jahren: Werde ich eines Tages in der Lage sein, Elektronen auf die Schliche zu kommen? Die Teilchen galten damals als unmessbar schnell. Es gab kein Werkzeug, um sie zu beobachten oder zu vermessen.Ferenc Krausz
Zu den Pflichten eines Nobelpreisträgers gehört es, vor der Verleihung am kommenden Wochenende das eigene Fachgebiet möglichst verständlich zu präsentieren. Wo werden Sie anfangen?
Sinnvollerweise fängt man mit der Fragestellung an, die einen ursprünglich umgetrieben hat. Bei mir lautete diese vor vielen Jahren: Werde ich eines Tages in der Lage sein, Elektronen auf die Schliche zu kommen? Die Teilchen galten damals als unmessbar schnell. Es gab kein Werkzeug, um sie zu beobachten oder zu vermessen.
Was für Werkzeuge braucht es dafür?
Im Prinzip eine sehr, sehr schnelle Kamera. Ein Beispiel: Will ich einen Formel-1-Rennwagen auf der Ziellinie fotografieren, geht das nur mit einer extrem kurzen Belichtungszeit. Andernfalls verwischt die Aufnahme. Das ist bei Elektronen nicht anders.
Und wo liegt das Problem, eine derart schnelle Kamera zu entwickeln?
Die Physik setzt hier die Grenzen. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Sie brauchen mindestens einen kompletten Wellenzug, um eine Aufnahme zu machen. Im Bereich des sichtbaren Lichts beträgt diese Wellenlänge etwa 2,5 Femtosekunden – das sind Millionstel Teile einer Milliardstelsekunde. Mit solchen Laserpulsen lässt sich zwar wunderbar beobachten, wie chemische Bindungen in Molekülen aufbrechen, für Elektronen sind sie aber noch immer viel zu langsam.
Wieso?
Elektronen sind etwa 2000-mal leichter als das leichteste Atom, Wasserstoff. Entsprechend schneller sind sie unterwegs. Um ihnen auf die Spur zu kommen, braucht es eine tausendfach höhere Zeitauflösung als bei der Beobachtung molekularer Prozesse, wobei sich ganze Atome innerhalb des Moleküls bewegen – und das bringt uns zu Belichtungszeiten im Bereich von Attosekunden, Milliardstel einer Milliardstelsekunde.
Wir haben die Messung zunächst einige Male wiederholt, um sicher zu sein, dass wir tatsächlich und unmissverständlich den Nachweis eines Attosekundenpulses sahen. Dann waren wir uns aber sicher: Ja, das ist es!Ferenc Krausz
Wie konnten Sie die Physik letztlich überlisten?
Indem wir zunächst die Femtosekundentechnologie bis an ihre Grenzen, sprich: Laserpulse mit einem Feld-Oszillationszyklus, entwickeln, um dann diese Pulse auf Neonatome richten zu können, die millionenfach aus einer Düse strömen. Die positive Halbschwingung des starken elektrischen Feldes nahe der Pulsspitze schlägt ein Elektron aus einem Neonatom heraus. Die darauffolgende negative Halbschwingung der Welle drängt das Elektron zurück ins Atom. Dabei wird eine große Portion Energie in Form ultravioletter Strahlung frei. Der Prozess passiert gleichzeitig – nahezu perfekt synchronisiert zueinander – in Millionen von Atomen, die alle demselben Laserpuls ausgesetzt sind. Der gesamte Prozess läuft innerhalb eines Bruchteils der Wellenlänge des Femtosekundenlasers ab. So entsteht ein neuer ultravioletter Lichtblitz im Attosekundenbereich, transportiert in einem kollimierten, laserähnlichen Strahl. Genau das, was wir wollen.
Rund um die Jahrtausendwende waren Sie mit dieser Arbeit nicht alleine. Auch Pierre Agostini, der nun ebenfalls den Nobelpreis erhalten wird, hatte Attosekundenpulse erzeugt.
Ja, allerdings arbeiteten alle anderen Gruppen mit Laserpulsen, die aus vielen Wellenzyklen bestehen. Daher wiederholte sich der vorhin beschriebene Erzeugungsprozess bei jeder Halbperiode des Laserlichts. Das Resultat war eine ganze Reihe von Pulsen hintereinander. Wir hingegen konnten die Dauer unseres Femtolasers auf eine Schwingungsperiode begrenzen und damit erstmals einen einzelnen Attoblitz erzeugen. Die anderen Gruppen haben mit einer Kamera gearbeitet, die klack, klack, klack gemacht hat. Zwar immer nur für kurze Zeit, aber mehrfach hintereinander. Unserer Kamera hingegen gelang eine einzelne Attosekunden-Aufnahme – nachts, im September 2001, in einem Kellerlabor der TU Wien.
Nachts?
Ja, wobei Nachtschichten damals unsere normale Arbeitsweise waren. Nachts sind die Bedingungen einfach am ruhigsten, insbesondere wenn das Labor – wie unseres – über einer U-Bahnlinie liegt, die empfindliche Experimente stört. Wir hatten zuvor allerdings auch viele Nächte durchgearbeitet, ohne einen Durchbruch zu erleben.
War Ihnen damals sofort klar, was passiert ist?
Wir haben die Messung zunächst einige Male wiederholt, um sicher zu sein, dass wir tatsächlich und unmissverständlich den Nachweis eines Attosekundenpulses sahen. Dann waren wir uns aber sicher: Ja, das ist es! Allerdings waren wir zu vorgerückter Stunde, um vier oder fünf Uhr in der Früh, zu müde, um das gebührend zu feiern. Die Freude in den kommenden Tagen war dafür umso größer.
Man denkt, dass man eine Tür aufgestoßen hat zu einer Welt, die vorher kein Mensch gesehen hat. Und dass nun sehr spannende Zeiten bevorstehen.Ferenc Krausz
Denkt man in dem Moment: Wow, ich habe etwas Großes entdeckt, vielleicht sogar etwas Nobelpreiswürdiges?
Nein, das ist nicht der erste und auch nicht der zweite Gedanke. Man denkt vielmehr, dass man eine Tür aufgestoßen hat zu einer Welt, die vorher kein Mensch gesehen hat. Und dass nun sehr spannende Zeiten bevorstehen. Und der unmittelbar darauf folgende Gedanke: Was tun wir als Erstes damit?
Zwanzig Jahre später geht es längst nicht mehr nur um die Beobachtung von Elektronen. Welche Anwendungen bietet die Attosekundenphysik?
Wir hoffen, dass sie längerfristig bei der Entwicklung schnellerer Computer behilflich sein kann. Bislang hat sich die Industrie darauf konzentriert, Schaltkreise immer kleiner zu machen und so die Rechengeschwindigkeit zu steigern. Das wird aber bald an physikalische Grenzen stoßen. Ein Ausweg liegt darin, sich Gedanken zu machen, wie man weitere Fortschritte in der vierten Dimension, in der Zeit, machen kann, über die Erhöhung der Taktfrequenz der Chips – langfristig bis hin zur Frequenz von sichtbarem Licht. In Experimenten konnten wir zeigen, dass sich die Frequenz um den Faktor 100.000 steigern lässt. Die Attosekundenphysik kann dabei eine wesentliche Rolle spielen – als Messtechnik.
Rund um die Bekanntgabe des Nobelpreises war auch viel von medizinischen Anwendungen die Rede.
Darauf liegt seit einigen Jahren sogar unser Hauptaugenmerk. Die Idee: Wir bestrahlen Blutplasma mit einem infraroten Laserblitz. Dieser regt die im Blut befindlichen Moleküle an, die ihrerseits ebenfalls Strahlung abgeben – und zwar ganz charakteristisch, wie eine Art Fingerabdruck. Dieses Signal können wir mit unserer Attosekunden-Messtechnik präzise abtasten. Sofern eine Krankheit die Zusammensetzung der Moleküle im Blut und somit diesen „Infrarot“-Fingerabdruck verändert, könnte diese Änderung dazu genutzt werden, um Krankheiten in einem frühen Stadium zu erkennen. Erste ermutigende Anzeichen dafür sehen wir bei Lungenkrebs.
Interview: Alexander Stirn
Nobelpreis: Award Ceremonies on 10 December