Nanomaschinen nach Maß: Protein-Design mit Künstlicher Intelligenz
22.08.2025
Biophysiker Lukas Milles erforscht am Genzentrum der LMU, wie sich mithilfe von Deep Learning vollkommen neue Proteine konstruieren lassen.
22.08.2025
Biophysiker Lukas Milles erforscht am Genzentrum der LMU, wie sich mithilfe von Deep Learning vollkommen neue Proteine konstruieren lassen.
Proteine sind die Grundbausteine des Lebens. Sie setzen unsere Zellen zusammen, steuern den Stoffwechsel, sind Teil unseres Immunsystems – und auch der Waffen, mit denen Krankheitserreger uns attackieren. Lange galt es als nahezu unmöglich, neue Proteine mit gezielten Funktionen am Reißbrett zu entwerfen. Doch das ändert sich gerade.
„Wir forschen an De novo Proteindesign“, erklärt Lukas Milles, seit 2024 Professor und Arbeitsgruppenleiter am Genzentrum der LMU. „Wir entwickeln also völlig neuartige Proteine, die es in der Natur so nicht gibt.“ Die jüngsten Fortschritte im Bereich Künstlicher Intelligenz haben das Ziel, Proteine mit maßgeschneiderten Eigenschaften zu erzeugen, in greifbare Nähe gerückt. Das Anwendungspotenzial ist groß: So kann man beispielsweise Wirkstoffe entwerfen, die schädliche Bakterien gezielt blockieren, oder neuartige Vakzine entwickeln. Ein erster Impfstoff, der durch diesen Prozess entstand, ist seit 2022 auf dem Markt.
Wir entwickeln völlig neuartige Proteine, die es in der Natur so nicht gibt.Lukas Milles
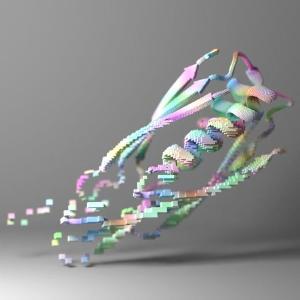
Mithilfe von Deep-Learning lassen sich völlig neue Proteine designen, die später im Labor auf ihre Funktion getestet werden können. | © Ian C. Haydon
„Zuerst überlegen wir uns konzeptionell genau, wie unser Wunschprotein aussehen soll – tatsächlich oft mit Zettel und Bleistift.“ Anschließend werden die Konzepte mathematisch beschrieben und über neuronale Netzwerke in dreidimensionale Proteinstrukturen übersetzt. „Das kann man sich vorstellen wie die Erstellung eines KI-Bilds, bei dem man ein Wunschmotiv beschreibt und die KI generativ verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten vorschlagen lässt“, so Milles. Der Biophysiker steuert entsprechend ein Deep Learning Modell in die Richtung gewünschter Protein-Designs.
Während man bei KI-erstellten Texten und Bildern in der Regel versucht, sogenannte Halluzinationen zu vermeiden – etwa dass die Figuren plötzlich nicht zwei, sondern drei Hände haben – erzwingt Milles diese sogar gezielt: „Wir wollen als Ergebnis keine leichten Variationen natürlicher Proteine, sondern ganz neue Lösungen, wie sie in der Natur nicht vorkommen.“ Denn drei Hände könnten schließlich, je nach Anwendung, auch ganz nützlich sein.
Ob die berechneten Protein-Designs auch wirklich funktionieren, überprüft Milles Team im Labor. „Proteine sind Aminosäure-Sequenzen. Diese Sequenzen lassen wir von Zellen herstellen, meist von Bakterien, die genetisch so modifiziert sind, dass ihre Gene für unsere Proteine kodieren.“ Es entsteht ein langer Aminosäure-Faden, der sich zu Strukturen zusammenknäuelt wie ein verheddertes Telefonkabel. Im Anschluss wird experimentell überprüft, ob der molekulare Kabelsalat wirklich die gewünschten Eigenschaften hat. „Diese dreidimensionale Anordnung zu kontrollieren und vorherzusagen war bislang extrem schwierig und konnte erst durch Deep-Learning-Ansätze verlässlich gelöst werden“, so Milles.

Prof. Lukas Milles | © LMU / Jan Greune
Trotzdem spuckt die KI natürlich nicht nur Treffer aus. Je nachdem, wie komplex das Problem ist, an dem die Forschenden arbeiten, kann es sein, dass sich nur eins von hundert Designs im Labor bewährt. „Biologische Systeme sind enorm komplex. Sie verhalten sich nicht wie ein Uhrwerk, bei dem man an einem Rädchen dreht und genau weiß, was passiert.“ Oft gebe es keine einfachen Antworten, sagt Milles. Das sei zwar manchmal frustrierend, mache aber auch den Reiz seines Forschungsgebiets aus.
Milles war mittendrin, als sich das Feld in rasantem Tempo entwickelte: Nach Studium und Promotion an der LMU, wo er sich bereits früh mit Einzelmolekül-Biophysik beschäftigte, forschte er in Seattle bei David Baker, beim Godfather of Protein Design sozusagen, der 2024 für seine Deep-Learning-Technologie den Chemie-Nobelpreis erhielt. 2024 kehrte Milles über das Emmy-Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft ans MPI für Biochemie und die LMU zurück, inzwischen mit einer eigenen Professur.
Biologische Systeme sind enorm komplex. Sie verhalten sich nicht wie ein Uhrwerk, bei dem man an einem Rädchen dreht und genau weiß, was passiert.Lukas Milles
Ein prägender Moment in seiner Forschungskarriere? „In meiner Doktorarbeit habe ich ein Messsystem benutzt, bei dem man akustisch hören konnte, was im Experiment passiert. Als ich ein neues Protein-System testete, gab es plötzlich ein ungewöhnlich lautes Rauschen – ich dachte, das Instrument ist kaputt. Aber es war tatsächlich ein spezifisches Signal. Und es war stärker als alles, was wir zuvor vermessen hatten.“
Auch in der Postdoc-Phase in den USA gab es einen solchen Heureka-Moment: Milles musste eine bestimmte chemische Bindung nachweisen, die sich dadurch zeigt, dass das untersuchte Protein 17 Dalton an Masse verliert. „Ich wühlte mich durch die Datensätze und irgendwann tauchte tatsächlich zum ersten Mal diese 17 in den Ergebnissen auf und ich wusste, es hat geklappt“, erinnert er sich. „Das waren dreieinhalb Jahre Arbeit für diese eine Zahl, die mir anzeigte, dass sich ein Ammonium-Ion von meinem Protein abgespalten hatte.“
Bakterien haben ganz faszinierende Mechanismen entwickelt. Wenn wir diese besser verstehen und nachbauen können, schaffen wir es vielleicht, sie umzudrehen, um die Bakterien zu blockieren.Lukas Milles
Über die Jahre hatte Milles mehrfach die Möglichkeit, aus der Forschung auszusteigen und sich in Richtung der angewandten Forschung in der Industrie zu orientieren oder in Start-Ups einzusteigen. „In der Grundlagenforschung bin ich geblieben, weil sie einerseits so wichtig ist und weil man darin große Freiheiten hat, neue Ansätze auszuprobieren.“
Protein-Design ist ein äußerst interdisziplinäres Feld an der Schnittstelle von Biologie, Physik, Chemie und Informatik. „Die LMU ist in diesen Disziplinen exzellent aufgestellt und vernetzt“, sagt Milles. Er ist Mitglied im Exzellenzcluster BioSystem , in dem Forschende von LMU und TUM gemeinsam biologische Prozesse mithilfe ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien designen wollen.
Aktuell arbeiten Milles und sein Team daran, bestimmte Proteine, mit denen Pathogene menschliche Zellen angreifen, besser zu verstehen. „Bakterien haben ganz faszinierende und auch teilweise nicht sehr intuitive Mechanismen entwickelt, die extrem gut funktionieren“, erklärt er. „Wenn wir diese Mechanismen besser verstehen und nachbauen können, schaffen wir es vielleicht, sie umzudrehen, um die Bakterien zu blockieren.“ Denn mithilfe des De-novo-Protein-Designs könne man durch die Konstruktion neuer Proteine auch etwas darüber lernen, wie natürliche Proteine funktionieren.